 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
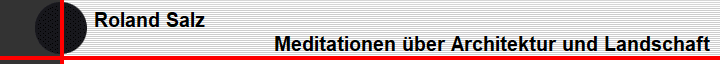 |
|||
|
Zen-Kunst
Eines Tages sagte ein Mann aus dem Volk zu Zen-Meister Ikkyû: „Meister, wollt Ihr mir bitte einige Grundregeln der höchsten Weisheit aufschreiben?“ Ikkyû griff sofort zum Pinsel und schrieb: „Aufmerksamkeit.“ „Ist das alles?“ fragte der Mann. „Wollt Ihr nicht noch etwas hinzufügen?“ Ikkyû schrieb daraufhin zweimal hintereinander: „Aufmerksamkeit. Aufmerk- samkeit.“ „Nun“, meinte der Mann ziemlich gereizt, „ich sehe wirklich nicht viel Tiefes und Geistreiches in dem, was Ihr gerade geschrieben habt.“ Daraufhin schrieb Ikkyû das gleiche Wort dreimal hintereinander: „Aufmerk- samkeit. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.“ Halb verärgert begehrte der Mann zu wissen: „Was bedeutet dieses Wort ‚Aufmerksamkeit‘ überhaupt?“ Und Ikkyû antwortete sanft: „Aufmerksamkeit bedeutet Aufmerksamkeit.“ Zitiert nach Philip Kapleau, Die drei Pfeiler des Zen
Als eine Form des Buddhismus, genauer gesagt des Mahayana-Bud- dhismus, welcher durch seine Anhänger von Indien nach China ge- bracht worden war, ist der Zen dort, im Reich der Mitte, im fünften nachchristlichen Jahrhundert entstanden, mehr als 800 Jahre nach dem Tod des Buddha (ca. 400 v.Chr.). Als sein Begründer gilt Bodhidharma (ca. 440-528), der 28. Patriarch des indischen Buddhismus und erste Patriarch des Zen. Im 11. Jahrhundert, also nach weiteren 600 Jahren, gelangte der Zen-Buddhismus durch Mönche nach Japan, wo er bis heute praktiziert wird. Erst im 20. Jahrhundert, noch einmal 900 Jahre später, als das Inselreich sich zur Welt öffnete, breitete er sich von hier aus weiter nach Amerika und Europa aus. Das Konzept der Künste, die sich auf den Zen-Buddhismus gründen und von ihm durchdrungen sind, ist in Japan entstanden. Bekannt ist etwa Zen in der Kunst des Bogenschießens (nicht zuletzt durch das gleichnamige, 1948 erschienene Buch des deutschen Philo- sophen Eugen Herrigel, der hierin auf packende Weise seine Erfah- rungen bei einem japanischen Meister dieser Kunst beschreibt), die Zen-Kunst des Schwertfechtens, aber auch der Teezeremonie oder des Blumensteckens. Der Amerikaner Robert M. Pirsig veröffentlichte 1974 einen Bestseller-Roman mit dem Titel „Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten“. Zen-Künste gibt es also viele. Was aber macht ihr Wesen aus? Zen zu praktizieren heißt in erster Linie zu meditieren, „Zazen“ zu üben, oder einfach: zu „sitzen“, wie es dort heißt. Zen ist eine religiöse Bewegung, die sich in China und Japan weitgehend innerhalb eines klösterlichen Umfelds entwickelt hat, geprägt von strenger Disziplin des Tagesablaufs. Erst im 20. Jahrhundert ist er, jetzt über mehrere Kon- tinente verteilt, ganz überwiegend zu einer Laienbewegung geworden, und die meisten Zen-Meister unterrichten heute nicht mehr in tradi- tionellen Klöstern. Zazen, die Meditation, die tiefe Konzentration auf einen Gegenstand im weitesten Sinne, die innere Versenkung sind aber seine Wesensmerkmale geblieben und selbst die spezifische Übungs- weise erfuhr bis heute kaum Veränderungen. Warum aber starren die Schüler des Zen jahre- und nicht selten jahrzehntelang gegen eine Wand, zählen ihre Atemzüge oder versuchen, vom Meister angetrieben, scheinbar völlig paradoxe Fragen oder Aufgaben zu lösen? Die me- ditative Versenkung soll den Geist zur Ruhe bringen, das ständige Kreisen der Gedanken, um dadurch zu erkennen, was hinter diesen Gedanken liegt, im eigenen Selbst. In letzter Konsequenz sucht der Zen-Schüler die Erfahrung des Einswerdens von Subjekt und Objekt, von Betrachter und Betrachtungsgegenstand, er ringt um das Bewußt- sein, nicht ein losgelöstes Einzelnes, sondern ein Teil des Ganzen zu sein. Die Praxis des Zen ist unglaublich hart. Jeder, der schon einmal ein Sesshin, eine mehrtätige gemeinschaftliche Meditationsklausur unter der Anleitung eines Zen-Meisters besucht hat, weiß das. Das stundenlange, völlig regungslose und schweigende Sitzen in der traditionellen asiatischen Haltung stellt nicht nur an den Geist, sondern auch an den Körper enorme Anforderungen. Aber das Ziel, Bewußtsein von etwas zu erlangen, was im tiefsten Grund des einzelnen Menschen immer schon verborgen liegt und die Wirklichkeit als Ganzes umfaßt, ist, darf man den Zen-Meistern glauben, kaum anders als auf diesem Wege zu erreichen. Nur die wenigsten schaffen es. Doch auch für die übrigen ist dieser Weg des Zen nicht umsonst. Auch wenn man die letzten möglichen Erfahrungen nicht gemacht hat, wird man doch durch die kontinuierliche Praxis Stück für Stück eine immer tiefere innere Ruhe und Klarheit verspüren, die genügend Motivation darstellen, um fortfahren zu wollen. So wird der Weg selbst zum Ziel. Meditation als tiefe Konzentration auf einen Gegenstand im weitesten Sinne ist aber nicht nur im Rahmen strenger Zen-Praxis möglich. Meditation kann prinzipiell auf jeden beliebigen Gegenstand der Wahrnehmung gerichtet werden und auf jedes praktische Tun. Dabei wird man im Allgemeinen sagen können, daß die Meditation desto effektiver ist, je einfacher der gewählte Gegenstand oder die Tätigkeit. So kann jede Kunst, jeder Sport (ja sogar ein Kampfsport), aber auch jedes einfach häusliche Tun zum Gegenstand der Betrachtung, der Versenkung werden. Der Zen hat in Japan während seiner Hochblüte fast alle Bereiche des menschlichen Lebens erschlossen und durchdrungen. Das „Leben aus Zen“ (Titel der deutschen Übersetzung eines 1949 erschienen Buches des Japaners Daisetz Taitaro Suzuki, der den Zen maßgeblich in Amerika bekannt gemacht hat) ist eine Einstellung, die allem Wahrnehmen und Tun gegenüber angewandt wird, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Zen-Kunst stellt sozusagen einen zweiten Weg hin zu jenem Bewußtsein der Einheit des Selbst mit dem Anderen dar, einen Weg, der im klassischen Japan nicht an den Eintritt ins Kloster gebunden war, sondern der auch den Laien offenstand und der zu Hause praktiziert werden konnte. Dieser zweite Weg ist weniger steil, dafür aber um so länger, und er führt nur in den seltensten Fällen zu jenen tiefen inneren Erfahrungen, die im Rahmen der klassischen Zen-Schulung möglich sind. Dabei laufen auch die traditionellen japanischen Zen-Künste in strengen Ritualen ab, die für westliche Augen von geradezu provozierender Schlichtheit sind, wenn auch keineswegs einfach auszuführen, zumindest nicht im Hinblick auf die richtige innere Einstellung dabei. Dem Eingießen des Tees, dem Spannen des Bogens – von einem Europäer oder Amerikaner bestenfalls als notwendige Verrichtungen, als notwendiges Übel beim Teetrinken oder beim Bogenschießen angesehen, während man in Gedanken schon bei dem erwarteten Geschmack ist oder bei der Frage, wieviel Punkte der Schuß wohl macht – wird eine Bedeutung beigelegt, die ohne ein Wissen um die meditative Funktion dieses Tuns nicht nachvollziehbar ist. Und paradoxerweise ist es dann erst diese richtige innere Haltung, um die man jahrelang und bis zur Verzweiflung ringen muß, die einem dann das Spannen des großen Bogens überhaupt ermöglicht und die einen Meister zu einer kaum faßbaren Treffsicherheit des Pfeiles führt. Westliche, moderne Zen-Künste wie etwa diejenigen, ein Motorrad zu warten oder ein Gebäude zu betrachten, stellen demge- genüber bestenfalls einen dritten Weg zur meditativen Selbsterfahrung dar, einen Weg, der im Vergleich mit den oben beschriebenen so flach verläuft, daß er sich, mit bloßem Auge betrachtet, in der Ebene fort- zusetzen scheint. Aber selbst ein solcher, zugegebenermaßen be- scheidener Weg vermag doch vielleicht – an guten Tagen – plötzlich ein wenig von den meditativen Erfahrungen zu offenbaren, die heutzutage viele Menschen, nicht nur Buddhisten, zu regelmäßiger Praxis motivie- ren.
Weiter zu Zen in der Kunst der Architekturbetrachtung
|
|||
|
Die Seiten und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt! Copyright © Roland Salz 2000 - 2025 Version 18.1.2025 |
|||