 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
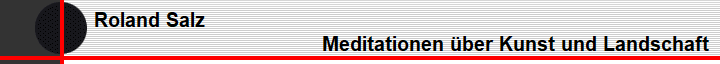 |
|
|
||||||||||||||||||
|
V.1. Die Droschke am Ende der Gasse
An der Place du Forum, mitten im Herzen der Altstadt von Arles, steht heute das Café van Gogh. Durch die gelben, hell angestrahlten Wände, die ebenfalls leuchtend gelben Segel, mit denen die Überdachung der Terrasse abgehängt ist, durch die Aufschrift „Café de nuit“ über einem der beiden nebeneinanderliegenden, rot eingefaßten Eingänge, vor allem aber durch die einzelne, große Gaslaterne, die sich an einem langen, schmiedeeisernen Arm von der Wand aus auf den Bereich der Terrasse vorschiebt, fällt dem Passanten, dem nächtlichen Flaneur die Assoziation nicht schwer zu jenem Gemälde van Goghs, das wohl sein bekanntestes und beliebtestes überhaupt ist: die Caféterrasse bei Nacht. Wer erinnert sich nicht an jene Szene, 1956 gedreht, aus Vicente Minellis Verfilmung des Romans von Irving Stone „Vincent van Gogh - ein Leben in Leidenschaft“? Da sitzen Kirk Douglas und Anthony Quinn – als Vincent van Gogh und Paul Gauguin – vor genau diesem Café, trinken Absinth, streiten sich, diskutieren erhitzt über ihre unterschiedlichen Auffassungen von Kunst. Auf dem Bild, das van Gogh im September 1888 malt, ist das Tischchen, an dem die beiden Maler in dem Hollywood-Streifen sitzen sollten und an dem sie – wer weiß – vielleicht wirklich bald gesessen haben, noch leer. Gauguin ist noch nicht eingetroffen, aber Vincents Bewußtsein schon ganz von der bevorstehenden und ersehnten Ankunft seines Freundes erfüllt. Später wird er noch einmal auf die Ankunft des Freundes warten, genauer: auf die Rückkehr nach dessen überstürzter Abreise aus Arles im Dezember 1888. Aber dann wird es vergeblich sein. Das Gelbe Haus, das den Freund während zweier Monate beherbergt hat, ist wie verlassen, und Vincent malt, um seiner Traurigkeit Ausdruck zu verleihen, zwei leere Stühle, je auf einem eigenen Bild: seinen eigenen, mit einer Pfeife darauf liegend, und dann den seines Freundes, mit zwei Büchern und einer brennenden Kerze. Und genauso unterschiedlich, wie diese Stühle des Gelben Hauses gemacht sind, so verschiedenartig sind auch die beiden noch leeren Stühle vor der Terrasse des Cafés, die wie vom Maler hingestellt erscheinen, damit sein Freund und er bald darauf Platz nähmen: während der eine eher zerbrechlich wirkt, dafür mit weit ausgeschwungener, bequemer Rückenlehne, steht der andere breit gelagert, muß sich aber mit einer asketisch schmalen Sitzfläche und einer ebensolchen Lehne zufriedengeben. Das erst vor kurzem erfundene Gaslicht, das nun die Provinz erobert und auch hier die Nacht zum Tag macht, inspiriert die Künstler. Die Meinungen der Zeitgenossen gehen auseinander: ist das grelle, blendende Licht ein Affront gegen den gewohnten, stillen Schein der Kerzen und der Sterne am Himmel? Oder ist es ein Gewinn für die Menschheit, ein neuartiger, berauschender Lichtquell in der tiefen, dunklen Nacht? Vincent van Gogh will es genau wissen, er will das neuartige Phänomen so malen, wie es wirklich ist, und so zieht er nachts mit Staffelei, Leinwand und Palette beladen aus, stellt sich auf die Place du Forum und malt im Schein mitgebrachter Kerzen, die er sich auf die breite Krempe seines Strohhutes aufpflanzt. Von einer einzigen Gaslaterne also wird die Terrasse des Nachtcafés beleuchtet, und ihr Licht ist so gleißend, daß sie, genau wie die Sonne, nicht direkt ins Auge gefaßt werden kann. Wände und Überdachung taucht sie in ein leuchtendes Gelb, aber die Laterne selbst bleibt, in genau derselben Farbe gemalt, unscharf, beinahe ohne Konturen. Die Holzplanken des Terrassenbodens leuchten orange, genau wie das Innere des Cafés, jenseits der beiden nebeneinanderliegenden Eingänge. Aber die Reichweite des Gaslichtes ist beschränkt, und so endet die gelbe Farbe schlagartig an der Vorderkante der Überdachung, macht abrupt dem Schwarz der Gasse, dem fahlen Blaugrau der oberen Fassaden (vielleicht vom Mond beschienen) und darüber einem dunkelblauen Sternenhimmel Platz. So gewaltig das gelbe Licht die Terrasse des Cafés anfüllt, so machtvoll bleibt andererseits – natürlich wieder im Sinne eines Komplementärkontrastes – dieses Blauviolett des Firmaments, das die ganze Stadt umfaßt. Übergroß und geheim- nisvoll leuchten die Sterne, hellgelbe Flecken mit weißen Aureolen, verteilt über eine blaue, pastose Farbfläche, der die rechtwinklig zueinander stehenden, waagrecht und senkrecht ausgeführten Pinselstriche und die schwarzen Schlieren dazwischen eine mystische Struktur verleihen. Unten in den Gassen drückt der Himmel die Häuserfronten aneinander, nur hier und da ist in den schwarzen Silhouetten der Schein eines schwachen, warmen Kerzenlichts zu sehen. Obwohl auch vor der Terrasse, auf dem schimmernden Straßenpflaster, noch eine Reihe von Tischen mit wackeligen Stühlen aufgestellt ist, sitzt dort niemand mehr. Auf dem Höhepunkt eines warmen Sonntagnachmittages, als die Straßen und Plätze mit flanierenden, sich gegenseitig grüßenden Spaziergängern gefüllt waren, mag sich auch hier der eine oder andere Gast, das eine oder andere Paar für eine Weile niedergelassen haben; doch jetzt bildet diese Reihe eine Art von Niemandsland, eine Übergangszone, einen vorgeschobenen Posten sozusagen, den man um diese späte Stunde wieder geräumt und dem nächtlichen Abglanz des Kopfsteinpflasters überlassen hat. Nur noch in der Nähe der Türen zum Inneren des Cafés haben sich unauffällige, dunkel gekleidete Figuren um die runden Tischchen zusammengedrängt. Andere kommen von der gegenüberliegenden Straßenseite begierig auf das Nachtcafé zu, wie die Motten, die vom Kunstlicht desto unaufhaltsamer angezogen werden, je mehr sie im Grunde wissen, daß ihre Zeit schon abgelaufen ist. Warum aber gehen diese Gestalten nicht hinein ins Innere des Cafés, das ein Noch-mehr an grellem Gaslicht verspricht? Warum bleiben sie hier draußen, wo das künstliche Licht der Laterne sich mit dem Sternenglanz auf dem Straßenpflaster mischt? Vielleicht sind diese Menschen, die sich jetzt aus der ganzen Stadt hier zusammenfinden, die in ihren undeutlich gezeichneten, verschlossenen Gesichtern Geheimnisse zu bewahren scheinen, vielleicht sind diese Menschen doch eher gewissen Fischarten vergleichbar, die allein im Brackwasser der Flußmündungen existieren können, in jenen so seltenen und labilen Übergangszonen vom Süßwasser zum Salzwasser. Vielleicht gehören sie zu jener Art von Wesen, die gerade in dieser und nur in dieser Atmosphäre aufleben können, in den wenigen Stunden, die zwischen dem Abebben nachmittäglicher Geschäftigkeit und einer wieder aufsteigenden Flut mitternächtlicher, alkoholgetränkter Trostlosigkeit, wie sie van Gogh in seinem Bild Das Nachtcafé nicht minder treffend charakterisiert hat, verbleiben? Was aber macht den Reiz dieses Übergangs, dieses Zusammentreffens zweier Welten aus, den diese Menschen suchen? Wenn man das Bild eine Weile betrachtete, so meint man, die Nacht zu hören, der die Gäste des Cafés von ihrer gedämpften Behaglichkeit aus lauschen. Vielleicht ist zwischen dem Klang der Gläser und der Teller da ein leichtes Rauschen des kühlen Abendwinds in den Bäumen zu vernehmen, oder aber das leise, hell kratzende Geräusch der ersten Platanenblätter, die ein Windstoß unsichtbar über die Köpfe des Pflasters hinwegtreibt. Manch einem wird auch das ferne Holpern hölzerner Wagenräder schon ins Bewußtsein treten, von einer Droschke, die aus der dunklen Gasse langsam näher kommt, ihr Geheimnis noch in sich bergend.
Weiter mit dem nächsten Kapitel
|
|
Die Seiten und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt! Copyright © Roland Salz 2000 - 2025 Version 18.1.2025 |
