 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
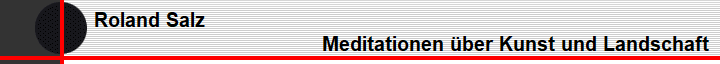 |
|
|
|
VII.3. "... man ist nicht allein im Glauben an das Wahre"
Jahre bevor er in die Provence aufbricht hat Vincent seinem Bruder Theo einmal in einem Brief bekannt: "... in der ganzen Natur, zum Beispiel in den Bäumen, sehe ich Ausdruck und sozusagen Seele.“ In seinem ganzen Schaffen geht es dem Maler darum, – durch eine äußerste Anspannung all seiner Kräfte – seine Bilder von dieser Seele der Menschen, der Pflanzen und der einfachen Dinge, die er unmittelbar erlebt, sprechen zu lassen. So auch in der „Vase mit Oleander und Büchern“, jenem Blumenstück, das er im August 1888 malt, kurz bevor er die Reihe der Sonnenblumenbilder beginnt. Auf einem unscheinbaren, weder links noch rechts bis an den Rand des querformatigen Bildes reichenden Holztisch steht eine kleine, krugförmige Vase aus Steingut. Darin ein überquellender, nach allen Seiten hin ausladender Strauch von Oleanderzweigen, mit lanzettförmi- gen, dunkelgrünen Blättern und schweren Büscheln rosafarbener Blüten. So sehr streben die Blütenstände an ihren langen Stielen nach außen, so sehr ist der Schwerpunkt des Strauches nach oben gerückt, daß es nur seinem geschickten Arrangement zu verdanken ist, seiner gleichmäßigen Verteilung nach allen Seiten, daß der kleine, lasierte Krug nicht umkippt. Er ist etwas bauchig und farblich zweigeteilt: unterhalb des unteren Henkelansatzes ist er blaß blaugrün; im oberen Teil hebt sich von einem schwarzen Grund ein Pflanzenzweig ab, der farblich dem Oleander entspricht: dunkelgrüne Blätter und rote Blüten. Wieder ist der Hintergrund des Gemäldes einfarbig und flächig. Diesmal umgibt ein gelbliches Grün Tisch und Strauch. Die Farbe ist pastos in breiten Pinselstrichen aufgetragen, die sich als Senkrechten und Waagrechten durchkreuzen und überlagern, wie aus grobem Material geflochten. Außer der Vase befinden sich noch zwei Bücher auf dem Tisch, übereinanderliegend. Auf dem oberen, mit gelbem Einband, sind sowohl Titel als auch Autor gut zu lesen: La joie de vivre von Emile Zola. Aber die beiden Bücher sind so sehr an den linken Tischrand geschoben, daß sie schon ganz auf der Kante liegen. Ihr Gleichgewicht ist genauso labil und gefährdet wie dasjenige der Keramikvase. La joie de vivre, die Freude am Leben, scheint vor allem den Oleanderstrauß erfaßt zu haben. Beinahe ist es, als tanzten seine langen grüne Blätter im Wind, die langen Stiele mit den schweren Blütenständen meint der Betrachter auf und ab wippen zu sehen, wie wenn ein Sturm den ganzen Strauch hin und her wirft. Das wild bewegte Leben des Oleandergebüsches in einer vom Mistral aufge- wühlten Provence lebt in van Goghs Gemälde fort. Und doch sitzen die Oleanderzweige nicht mehr fest und drahtig auf ihrem Gebüsch, sondern sie stehen abgeschnitten in einer kleinen, schmalen Vase. Dieser kleine Krug und das Wasser darin sind jetzt ihre einzige Lebensader. Und obwohl dieses Wissen sie zur Vorsicht gemahnen sollte, können sie nicht davon lassen, sich zu bewegen, wild, ungestüm, lebenshungrig, wie sie es immer getan haben. Fast ahnen sie schon, daß sie es übertreiben werden. Sie sehen mit klarem Bewußtsein das drohende Unheil kommen, das sie heraufbeschwören. Und trotzdem lassen sie von ihrer Ekstase nicht ab.
Auch Vincent van Gogh scheint im August gewußt zu haben, was auf ihn zukommt. Mitten in der Euphorie des Malens, seiner rauschhaft wie nie zuvor erlebten Kreativität, ist er sich dessen gewahr, daß er kräftemäßig weit über seine Verhältnisse lebt. Im Oleanderbild hat er beides ausgesprochen: die Freude am Leben, die ihn ergriffen hat, die ihn trägt, die ihn mitnimmt, und die Drohung, die damit verbunden scheint: die Vase wird umstürzen und das Buch vom Tisch herunterfallen; was bleibt wird ein Scherbenhaufen sein.
Vincent van Gogh soll sich von dem Anfall am 23. Dezember 1888 nie wieder erholen. Nur einen Monat nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wird er aufgrund einer Petition Arleser Bürger als gemeingefährlicher Wahnsinniger verhaftet und erneut im Krankenhaus interniert. Zwar kommt er durch die Vermittlung seines Bruders schließlich wieder frei, aber er ist gezwungen, die Stadt und das Gelbe Haus auf immer zu verlassen. Was aber noch schlimmer ist: es wiederholen sich die Anfälle paranoider Umnachtung, die den Maler hilflos machen wie ein Kind. Er ist verzweifelt, müde und bittet den Bruder darum, in einem Heim untergebracht zu werden, in der Hoffnung, sich vielleicht hier wieder zu erholen. Im Mai 1889 trifft er in der Nervenheilanstalt in Saint-Rémy in der Provence ein, wo er über ein Jahr lang, bis drei Monate vor seinem Selbstmord, unter Geisteskran- ken leben – und malen – wird. Die Anfälle verschwinden, aber dann treten sie unvermittelt wieder auf. Als die Kunstwelt endlich beginnt, von Vincents Arbeiten Notiz zu nehmen, ist der Maler unheilbar krank. Im Februar 1890 schreibt Vincent aus Saint-Rémy an seine Schwester Wil: „Bei solchen Gedanken kommt mir, aber nur ganz von fern, der Wunsch, ein anderer, ein Neuer zu werden und Verzeihung dafür zu erlangen, daß meine Bilder beinahe ein Angstschrei sind, wenn sie auch in der bäuerlichen Sonnenblume Dankbarkeit symbolisieren.“ Schon einmal hat er dem Bruder geschrieben, der ihn so sehr unterstützt: „Weißt Du, woran ich ziemlich oft denke? Ich habe es Dir schon früher gesagt: auch wenn ich mich nicht durchsetze, möchte ich doch glauben, daß das, woran ich gearbeitet habe, weitergeführt wird. Nicht unmittelbar, aber man ist nicht allein im Glauben an das Wahre. Und was kommt es schon auf den Einzelnen an! Mir ist, als sei es mit den Menschen wie mit dem Korn: wenn man nicht als Same in die Erde gesät wird, um zu keimen, was tut's, dann wird man eben zermahlen zum Brotbacken.“
Zurück zum Editorial
|
|
Die Seiten und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt! Copyright © Roland Salz 2000 - 2024 Version 24.4.2024 |
|
Die Seiten und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt! Copyright © Roland Salz 2000 - 2025 Version 18.1.2025 |
